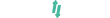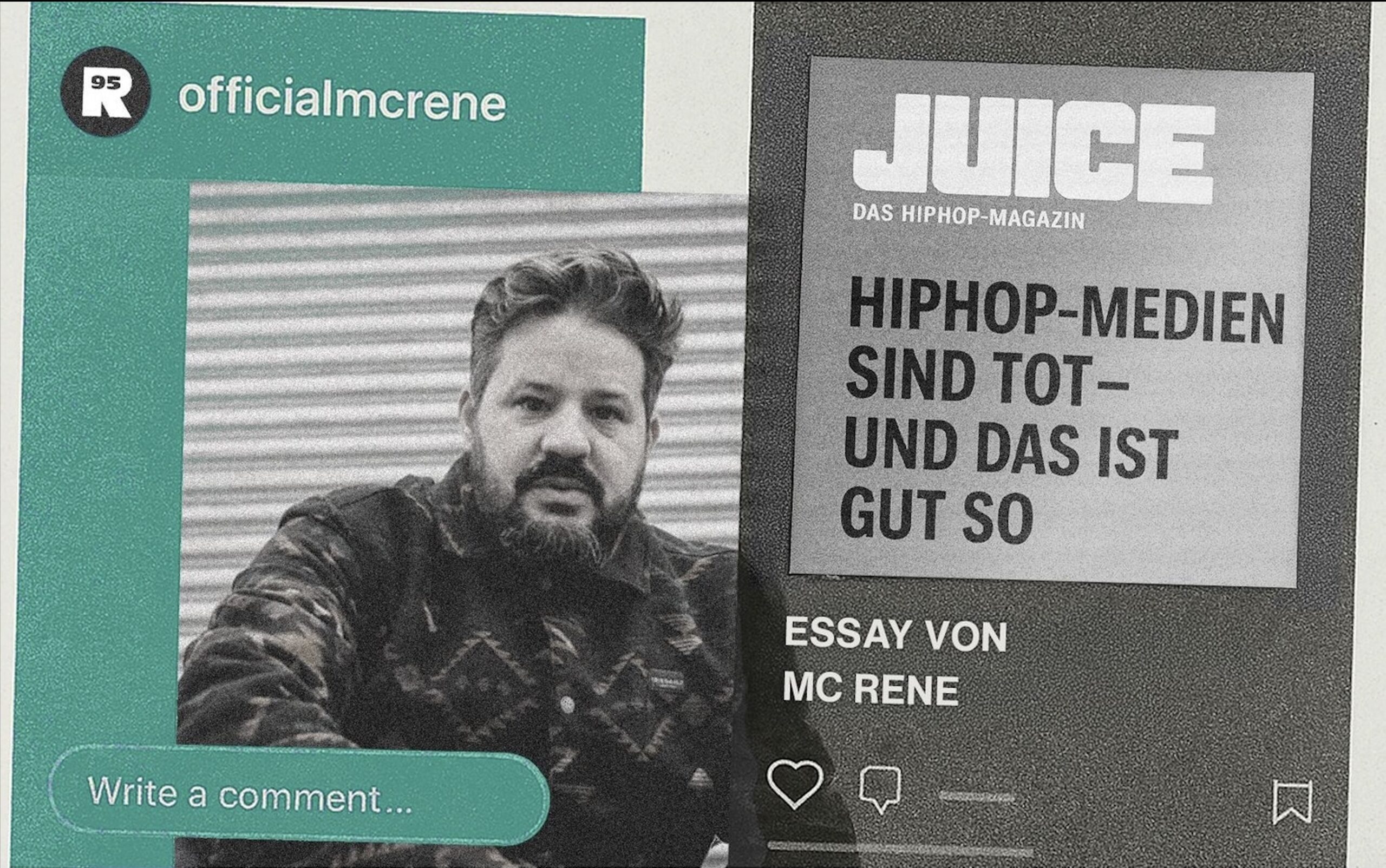MC René hat auf Instagram ein Essay veröffentlicht, in dem er das Ende klassischer Gatekeeper im Musikjournalismus konstatiert – und diesen Umbruch als Chance versteht. Sein Take: Früher hätten große Medienhäuser und Szenemagazine entschieden, wer gehört wird. Heute sei der Zugang offener, demokratischer – jede*r könne sich über Plattformen wie TikTok, Insta oder YouTube Sichtbarkeit verschaffen, ganz ohne Redaktion im Rücken. Statt Gatekeeping gebe es nun eine neue Selbstermächtigung. Was MC René sagt, stimmt. Aber es greift zu kurz.
Der Wegfall alter Gatekeeper bedeutet nicht automatisch Zugang – sondern häufig nur eine Verschiebung der Hürden. Was früher Chefredaktionen entschieden, regeln heute Algorithmen. Und ja – es gibt sie. Die, die trotzdem Formate aufbauen, sich Räume schaffen, ihre Stimme hörbar machen. Good for them. Aber sie kämpfen auf einer Bühne, deren Regeln nicht öffentlich verhandelt werden. Sondern von Plattformen diktiert, von Metriken bestimmt und von Markeninteressen gelenkt. Was sagt das über den Zustand dieser Branche, wenn Sichtbarkeit ≠ Substanz ist? Wenn Aufmerksamkeit zur Währung wird – und Musik nur Mittel zum Zweck?
René selbst schreibt: „Was bleibt, ist Gossip mit Genre-Tag. Rap wird noch gecovert – aber nicht mehr gespiegelt.“ Und Influencer*innen übernehmen heute Funktionen, die früher Redaktionen hatten – mit anderen Interessen, anderen Maßstäben. Sichtbarkeit funktioniert fast ausschließlich über Inszenierung. Wer Inhalte schafft, aber sich selbst nicht mitverkauft, bleibt unsichtbar – unabhängig davon, wie relevant oder gut recherchiert der Beitrag ist. Und trotzdem machen viele mit. Müssen es vielleicht.
René bricht mit der romantisierten Vorstellung, es hätte mal eine gerechte Medienlandschaft im HipHop gegeben. Er schreibt: „Die Szene, die du vermisst, war vielleicht nie für dich gedacht.“ Seine Kritik trifft da einen wunden Punkt: die Nähe zur Industrie, elitärer Opportunismus, PR-Nähe. Die Szene war nicht für alle da – das stimmt. Allerdings: Der Rückzug der Medien war keine bewusste Entscheidung, sondern das Ergebnis eines schleichenden Kollapses. JUICE, Splash Mag und Rap.de verloren nicht nur Relevanz, sondern oft auch den Anschluss ans Digitale. Das „too cool for school“-Verhältnis gegenüber Social Media war mehr Grabstein als Haltung – und sind wir ehrlich: Es hatte seinen nicht unbeträchtlichen Anteil am unausweichlich langsamen Downfall. Und in diesem Vakuum übernehmen heute Influencer*innen Funktionen, die früher Redaktionen innehatten – mit anderen Interessen, anderen Maßstäben. Ich kritisiere nicht, dass Influencer*innen heute Diskurse prägen – ich erkenne ihre Rolle, ihre Wirkung, ihre Nähe zu Communitys an. Aber ich unterscheide sehr genau zwischen Haltung und Reichweite. Und um das klar zu sagen: Ich bin weder kulturpessimistisch noch nostalgisch. Aber ich frage mich, was verloren geht, wenn Kritik nur noch aus Likes besteht.
Was bleibt vom Musikjournalismus?
Der Preis für diesen Musikjournalismus im Selbstbedienungsmodus ist hoch: Kontext wird gekürzt, Kritik weichgezeichnet, Recherche zur Randnotiz. Musikjournalismus funktioniert zunehmend als verlängerter Arm von Major-Strukturen, weichgespült und glatt. Größere Plattformen sind auf die Bereitschaft von Artists angewiesen. Unabhängige journalistische Arbeit hingegen wird heute oft als Pro Bono verstanden. PR-Agenturen verdienen an jedem Pitch, während diejenigen, die aus Liebe zur Kultur schreiben, maximal mit einem Barter Deal abgespeist werden. René schreibt: „Macht es selbst. Kein Retter kommt.“ Dieser Impuls ist verständlich – aber nicht jede*r kann „mal eben“ im Alleingang einen Newsletter starten, Videos drehen, Communitys aufbauen. Sichtbarkeit ist keine rein persönliche Entscheidung, sondern eine Frage von Netzwerken, Zugang zu Technik, Zeit – und manchmal schlicht Glück. Wir haben selbst mit Mostdope ein Musikmagazin gestartet, aus Liebe zur Kultur – nicht, weil wir Reichweite gesucht haben. Unsere Texte entstehen unabhängig, oft spät nachts. Es wäre vermessen, uns als Alternative zu inszenieren. Aber der Diskurs, den René anstößt, betrifft auch uns, weil es close to home trifft. Wir schreiben, weil es uns nicht egal ist. Weil wir glauben, dass Kontext wichtig bleibt – auch wenn kaum Zeit und noch weniger Kompensation dafür da ist.
Noch einmal: Ich bin weder kulturpessimistisch noch nostalgisch. Aber ich will, dass Musikjournalismus wieder etwas mit Musik zu tun hat. Ich will nicht Teil eines Systems sein, das nur dann zuhört, wenn es auch klickt. Ich will nicht an diesem Dauerlauf der Selbstvermarktung und -inszenierung teilnehmen.
Denn ja: Ich kann laut. Ich kann mich inszenieren. Ich kann auch funktionieren. Aber ich will’s nicht müssen.