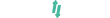Eigentlich ist es unüblich, ohne speziellen Anlass sechs Jahre nach Veröffentlichung auf ein Album zurückzublicken. Im Falle von Max Herres »Athen« gab es für mich persönliche Gründe, sich noch einmal gesondert mit der Platte auseinanderzusetzen. 2019 erschienen, habe ich zwei Jahre später das erste Mal das Album gehört. Vom ersten Ton an übte es eine unübliche Faszination auf mich aus, die weit über mein Interesse für Hip-Hop und die griechische Hauptstadt hinausgeht.
Als ich vor ungefähr einem Jahr begann, mich genauer auf »Athen« einzulassen, stieß ich auf eine Vielzahl an Themen, die in mir nach wie vor für Nachklang sorgen. Themen, die durch das metaphorische Gebilde Athens kaschiert werden und von denen das bloße Bild der Stadt schier die Spitze des Eisbergs darstellt. Wie der Zufall es wollte, war ich sogar über den letzten Jahreswechsel auch mehrere Monate in Athen, um meine Familie zu besuchen, wodurch die Stadt für mich mittlerweile auch zu einem derartigen Ort der Sehnsucht, wie ihn Herre beschreibt, geworden ist.
Realitätsflucht gen Mittelmeer
Zusammenfassend beginnt die Reise des Albums in einer Verfassung der Aufregung. Der Protagonist hält sich krampfhaft an makellosen Erinnerungen und einer idealisierten Vorstellung der Gegenwart fest, die lange nicht mehr der Gegenwart entsprechen. Die Antwort? Verdrängen, wie auf »Lass gehen« und die Flucht in ein Erlösung versprechendes Refugium – Athen.
In den ersten, von Tua gesungenen, Zeilen des titelgebenden Intro-Tracks »Athen« wird die Aussichtslosigkeit dieser Suche entlang der Balkanroute deutlich.
Fünf km/h aufm Seitenstreifen. Wie bring’ ich dich dazu, wieder einzusteigen? Wir kommen nie bis Athen und du wolltest so sehr nach Athen.
Max Herre – Athen
Während das Schicksal des lyrischen Ichs hier schon besiegelt scheint, wird deutlich, dass der Fokus nicht auf dem Erleichterung schaffenden Zielort selbst, sondern auf dem Prozess, diesen zu erreichen, liegt.
Auf den Spuren des Vaters

Was folgt ist ein lyrisch verpacktes Auf und Ab der Emotionen, in denen Herre mal mehr oder weniger tief in seine persönliche Historie blicken lässt. Auf »Terminal C (7. Sek)« gibt er einen Einblick in Kindheitserinnerungen, in denen sich schon früh eine traumabedingte Angst vor Veränderung erkennen lässt. Der Song beschreibt wehvoll die Momente, in denen er und seine Familie seinem Vater Frank nach einem kurzen Urlaub wieder Lebwohl sagen mussten. Dieser wurde damals als Architekt mit dem Bau des Athener Olympiakomplexs OAKA beauftragt und verbrachte deshalb mehrere Jahre in der griechischen Metropole.
Ein besonderer Bezug zu den OAKA-Kulissen wird auch im Musikfilm zum Album hergestellt. Diese dienen hier als Bindeglied zwischen diversen Ausschnitten der Musikvideos und werden immer durch eine Gruppe völlig maskierter Personen und eine griechische gedichtähnliche Erzählung begleitet.
Musikalisch bewegt sich Herre von Zuständen der Romantisierung (»Villa auf der Klippe« & »Fälscher«), der Überwältigung (»Nachts«), bis hin zur Erkenntnis, dass er sich lediglich etwas vorgespielt hat (»Diebesgut«) und dem wuterfüllten Wunsch, sich davon zu befreien (»Konny Kujau«).
Das Bild der erdrückenden Veränderung und der Wunsch ihr zu entfliehen stehen hier weiterhin stets im Vordergrund. Im Verlauf des Albums, scheint sich der Protagonist jedoch mehr und mehr damit zurechtzufinden. Immer wieder tauchen chronologische Knotenpunkte auf, die zeigen, wie sehr sich eine Situation über die Zeit verändern kann und dadurch einen Perspektivwechsel erfordert. Dies reicht vom Athener Stadtbild, das mittlerweile nicht mehr weitflächig von neoklassizistischen Gebäuden, sondern von mit Graffitis geschmückten Wohnhausblöcken (ποληκατοικίες) geprägt wird, bis zu Herres Rolle als Vater, in der er immer mehr und mehr Muster seiner eigenen Eltern in sich wiederfindet (»Siebzehn«).
Veränderung und Flucht im weltpolitischen Kontext
Einen politischen Exkurs, der sich diesem Thema angleicht, liefert der Künstler ebenfalls. »Dunkles Kapitel« setzt sich mit dem wachsenden Rechtsruck auseinander, der erschreckende Ähnlichkeit zu Geschehnissen im dritten Reich aufweist und sechs Jahre nach Veröffentlichung des Albums aktueller nicht sein könnte. Auch hier befinden wir uns eine geraume Zeit später wieder an einem ähnlichen Punkt, an dem wir uns nicht vor dem gewandelten Gesicht der Gesellschaft verstecken dürfen, sondern aktiv dagegen handeln müssen.
»Sans Papier« hingegen bietet das Gegenstück zu Herres Reise auf »Athen«. Auf der entgegengesetzten Spur der E75 beschreibt der Song den Weg fliehender Personen auf der Suche nach Schutz, Perspektive und einer Heimat, die ihnen in dem Lied letztendlich verwehrt bleibt. Parallelen werden hier unter anderem durch eine mazedonische Tankstelle und einen Weddinger Hinterhof gezogen, die im Intro ebenfalls erwähnt werden. Die zwei Orte, welche für die Akteure gänzlich unterschiedliche Bedeutungen haben, stehen sinnbildlich sowohl für eine Änderung in der Konnotation der Balkanroute als auch dafür, dass der Mensch per se immer auf der Suche nach einem besseren Zustand ist und sich gegebenenfalls auf die Realität und die eigenen Privilegien besinnen sollte.
Trotz aller Strapazen findet die von Herre beschriebene Odyssee schließlich im Outro »Das Wenigste«, in dem er von seiner Ehefrau Joy Denalane als Feature unterstützt wird, ein Ende. Obwohl die beiden hier vordergründig ihre eigene Beziehung und das Überwinden plagender Probleme beschreiben, lässt sich dieser Verlauf auch auf die anderen Motive des Albums beziehen. Durch die Auseinandersetzung der Veränderung und einem Verständnis dafür, dass es sich nicht lohnt, nicht existenten Utopien hinterherzujagen, findet letztendlich eine resignative Katharsis statt, die das gegenwärtige Leben wieder mehr als erträglich macht.
»Athen« ist eines dieser Alben, bei denen es sich lohnt, sich immer und immer wieder damit auseinanderzusetzen, weil man stets neue Aspekte entdeckt. Darüber hinaus ist es ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man als ein Künstler, der bereits Ende der 90er mit Freundeskreis den deutschen Hip-Hop geprägt hat, auch zwanzig Jahre später noch nachhaltige Alben machen kann. Auch wenn »Athen« sich teils antizyklisch nicht den gegenwärtigen „Richtlinien” des Streamingzeitalters angepasst hat, hat es keinesfalls an künstlerischem Wert oder Zeitlosigkeit verloren.